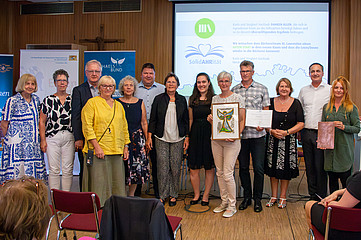mk online: Vom Münchner Vorstadtphilosophen Karl Valentin ist der Satz überliefert: „Die Zukunft war früher auch besser“ – würden Sie ihm beipflichten?
Generalvikar Christoph Klingan: Nicht unbedingt. Ich verstehe, was er meint, und schmunzle auch, aber ich denke, dass die Menschen zu allen Zeiten immer die Hoffnung hegen, dass es besser wird, weil man immer wieder mit neuen Herausforderungen konfrontiert ist. Ich glaube, dass wir heute genauso in die Zukunft blicken wie die Menschen früher und auch nicht genau wissen, was die Zukunft bringt. In der Kirche können wir, meine ich, dank der Frohen Botschaft Jesu Christi übrigens auch stets mit Optimismus nach vorne schauen.
„Trotz zurückgehender finanzieller und personeller Ressourcen will die Erzdiözese auch in Zukunft zuverlässig ihren kirchlichen Auftrag erfüllen“, hat es unlängst in einer Pressemitteilung geheißen. Und Kardinal Reinhard Marx hat kürzlich in einem Brief an die Pfarrgemeinden die Notwendigkeit benannt, „die vielfältigen Herausforderungen, vor denen die Kirche in unserer Erzdiözese steht, zu gestalten“. Das klingt alles gut und ehrenwert, aber sind Sie derzeit wirklich noch im aktiven Gestalten oder in Wahrheit bereits nurmehr im bloßen Reagieren?
Klingan: Mit dem Gesamtstrategieprozess haben wir die Chance ergriffen, noch aktiv gestalten zu können. Allerdings, und das muss man ganz nüchtern sehen, wird der Zeitraum perspektivisch immer kürzer. Wenn wir jetzt in Bezug auf die Zukunft nicht bestimmte Entscheidungen treffen und nicht die Möglichkeit nutzen, an der einen oder anderen Stelle aktiv Dinge zu verändern oder neu zu justieren, dann werden wir irgendwann in der Tat keinen Gestaltungsspielraum mehr haben.
Die Zeit drängt also?
Klingan: Ja. Es ist kein Geheimnis, dass momentan die Zahl der Kirchenaustritte sehr hoch ist und dass sich dies spürbar auf unsere finanziellen Möglichkeiten auswirken wird, weil diese nicht unwesentlich auf der Kirchensteuer basieren. Deswegen müssen wir gewisse Dinge verändern. Noch können wir das gestalten.
In den vergangenen Wochen zogen Sie zusammen mit Amtschefin Stephanie Herrmann und Finanzdirektor Markus Reif durch die Erzdiözese, um vor Ort und online mit Kirchenverwaltungsvorständen, Kirchenpflegerinnen und Kirchenpflegern, Vorsitzenden der Pfarrgemeindeund Pfarrverbandsräte sowie Verwaltungsleitungen zu sprechen. Sie möchten dabei über die Ergebnisse des Gesamtstrategieprozesses „Kirche gestalten + Wirkung entfalten“ und insbesondere über das Leitprojekt „Immobilien und Pastoral“ informieren. Was hat es damit auf sich?
Klingan: Das Leitprojekt „Immobilien und Pastoral“ greift ein wesentliches Thema aus dem Gesamtstrategieprozess auf. Es hat dort die Gemüter sehr bewegt. Einerseits bieten die vielen Immobilen, die wir besitzen und mit denen die Menschen auch etwas verbinden, eine große Chance, das Leben zu gestalten, aber andererseits stellt es auch eine große Last dar, diese Räume in der Form zu erhalten, dass dort auch weiterhin kirchliches Leben stattfinden kann. Um über dieses Projekt zu informieren und alle, die es betrifft, frühzeitig einzubinden, haben wir bereits drei Präsenzveranstaltungen in den verschiedenen Seelsorgsregionen und eine digitale Informationsveranstaltung angeboten; es haben jeweils rund 200 Personen daran teilgenommen. Es war spürbar, dass sich manche mit diesem Thema bereits auseinandergesetzt und erste Überlegungen begonnen haben. Andere realisieren aber erst jetzt, dass nicht mehr alles so weitergeführt werden kann wie bisher. Da war für manche schon auch eine Art Aha-Effekt wahrnehmbar.
Wie ist die Stimmung bei diesen Veranstaltungen?
Klingan: Ganz unterschiedlich. Wir erleben, dass am Ende Menschen auf uns zukommen und sich für die Informationen bedanken und das Projekt für sinnvoll erachten, weil sie selbst sehen, dass es angesichts zurückgehender finanzieller Mittel und steigender Lasten nicht immer so weitergehen kann wie bisher. Aber es gibt natürlich auch welche, die Kritik und Unverständnis äußern und sagen, die Erzdiözese hätte ausreichend Geld und Möglichkeiten, und die fragen, warum man bei ihnen vor Ort auf Veränderungen drängen würde.
Es heißt, die Erzdiözese wolle die Kirchenstiftungen unterstützen, die notwendigen Entscheidungen zu treffen. Wie soll das konkret funktionieren?
Klingan: Das Entscheidende steckt schon in Ihrer Frage: Es geht darum, dass die Kirchenstiftungen vor Ort entscheiden. Das ist zugleich auch die große Herausforderung. Wir wollen sie dabei unterstützen, weil wir der Überzeugung sind, dass die Kompetenzen vor Ort liegen, bei den Menschen, die das kirchliche Leben gestalten. Dort müssen auch rechtlich gesehen die Entscheidungen getroffen werden, weil jede einzelne Kirchenstiftung jeweils der Gebäudeeigentümer ist. Selbst wenn wir wollten, wir könnten gar keinen anderen Weg wählen, als gemeinsam mit den Kirchenstiftungen voranzugehen. Dabei reicht es aber nicht, nur die eigenen Gebäude zu betrachten, der Blick muss über die Grenzen der eigenen Kirchenstiftung hinausgehen – denn wenn man ein Pfarrheim vor Ort nicht mehr halten kann, muss man sehen, wo es ein anderes gibt, das man gegebenenfalls gemeinsam nutzen könnte.
Apropos Pfarrheim, jetzt einmal ein ganz praktisches Beispiel: Gesetzt den Fall, eine Kirchenverwaltung sagt, sie will das alte baufällige Pfarrheim aus den 1970er Jahren abreißen und den Grund neu bebauen, etwa mit Wohnungen, es fehlt aber das Geld für die Durchführung des Projekts. Würden Sie einen Investor mit ins Boot holen?
Klingan: Diese Entscheidung muss vor Ort getroffen werden. In so einer Konstellation ist es auf jeden Fall sinnvoll, noch einmal zu schauen, welcher Bedarf wirklich besteht. Für Kirchenstiftungen bietet sich etwa die Möglichkeit an, Grundstücke in Erbpacht zu vergeben und auf dieser Grundlage etwas zu entwickeln. Die andere Variante ist, etwas zu verkaufen – wobei es jetzt sicher nicht zum großen Ausverkauf von kirchlichen Grundstücken kommt. Weil wir in der Erzdiözese langfristig und in Generationen denken, ist es unser vorrangiges Ziel, Grund und Boden zu erhalten. Aber es ist auch klar, dass dieser sinnvoll genutzt werden muss, und eine Wohnbebauung ist sicher in manchen Fällen eine Option. Hierfür braucht es jemanden, der investieren kann, und damit sind häufig die Kirchenstiftungen und auch die Erzdiözese allein überfordert.
Externe Geldgeber sind damit kein Tabuthema mehr, oder?
Klingan: „Externe Kooperationspartner“ würde ich eher sagen. Was wir nicht tun und was auch unser Auftrag nicht vorsieht, ist, dass wir als Kirche kreditfinanziert große Projekte stemmen. Wir versuchen mit den finanziellen Möglichkeiten, die wir haben, zu gestalten. Deswegen werden wir sicherlich auch nicht mit irgendwelchen großen Immobilien-Mogulen riskante Geschäfte tätigen. Aber natürlich ist es auch ein Ziel dieses Projektes, besonders mit Blick auf die Bestandsimmobilien zu prüfen, ob eine gemeinsame Nutzung von vorhandenen Gebäuden mit einem Kooperationspartner in Frage kommt. Das ist zunächst einmal unsere Hauptstoßrichtung. Viele Pfarrheime sind es übrigens nicht, die sich in so schlechtem Zustand befinden, dass man sie abreißen müsste, aber es besteht häufig hoher Investitionsbedarf – und dieser ist allein oftmals nur schwer zu schultern.
Noch brisanter stellt es sich bei sakralen Gebäuden dar: Es gibt zahlreiche Kapellen oder Filialkirchen, die nicht mehr genutzt werden können. Könnte es sein, dass der eine oder andere Sakralraum profaniert werden wird, was bislang eine ganz seltene Ausnahme war, beispielsweise beim Bau des neuen Münchner Flughafens, als eine Kirche profaniert und abgerissen werden musste. Könnte das in der Zukunft vermehrt passieren?
Klingan: Es könnte kommen, aber ich glaube, dass es keine große Zahl sein wird, weil sehr viele Kirchen im Erzbistum unter Denkmalschutz stehen. Daher gelten hier noch einmal andere Anforderungen. Aber, und das wurde auch im Gesamtstrategieprozess ganz klar, es soll kein Tabu darstellen, Kirchen mitunter auch anders zu nutzen. Wir haben uns hierzu auch in anderen Diözesen informiert, beispielsweise im Bistum Essen, wo die eine oder andere Kirche mittlerweile anders genutzt wird. Wir waren vor Ort und haben uns das angeschaut. Dabei wurde uns deutlich vor Augen geführt, dass eine Umnutzung auch wieder einen Investitionsbedarf für notwendige Umbauten und Anpassungen auslöst, weil man eine Kirche eben nicht 1:1 einer anderen Nutzung zuführen kann. Zudem muss man hier stets die Frage stellen, was seitens des Denkmalschutzes und baurechtlich überhaupt möglich ist. Deswegen glaube ich auch nicht, dass dies die Lösung für sehr viele Konstellationen sein wird. Im Einzelfall kann es jedoch eine Perspektive sein, vor allem im Blick auf Kirchen jüngeren Baujahres, weil hier eher eine alternative Nutzung denkbar ist als bei einer kleinen Barockkirche auf dem Land.
Werden wir in Zukunft vermehrt baufällige Kirchen haben, die aufgrund fehlender Geldmittel weder renoviert noch umgenutzt werden können und daher einfach geschlossen sein werden?
Klingan: Das ist langfristig nicht auszuschließen. Es kann im Einzelfall dazu kommen, dass man eine Kirche aus bautechnischen Gründen nicht mehr erhalten kann und eine alternative Nutzung, bei der jemand mitinvestieren würde, nicht realistisch ist. Dann kann es dazu kommen, dass die eine oder andere Kirche dauerhaft geschlossen wird. Das gibt es heute auch schon in anderen Ländern, wo Kirchen in großer Zahl geschlossen wurden, etwa in Frankreich. In einem solchen Umfang kann ich mir das für unsere Erzdiözese aber nicht vorstellen.
Gibt es im Falle einer Umnutzung von Kirchengebäuden, egal ob Pfarrheim oder Sakralraum, irgendwelche „rote“ Linien?
Klingan: Wir haben keine roten Linien formuliert und definiert, aber es gibt de facto rote Linien, die auch vor Ort so wahrgenommen werden. Ich kann mir spontan nicht vorstellen, dass eine Pfarrkirche zum Beispiel zu einem Erlebnisbad umgebaut wird. Aber wir stellen bewusst keine Denkverbote auf. Realistischerweise werden aber alle, die sich mit einer alternativen Nutzung eines Kirchenraums auseinandersetzen, auch das Gepräge des Raumes, seine Architektur in ihre Überlegungen miteinbeziehen. Daher wird es auch bestimmte Grenzen geben, wie der Raum ausgestaltet werden
kann. In anderen Diözesen gibt es hier Lösungen als Veranstaltungsraum oder als Kolumbarium (eine bauliche Anlage oder ein Gebäude, das der Aufbewahrung von Urnen in einzelnen Nischen in einer Wand dient, Anm. d. Red.). Das sind realistische Alternativen. Aber dass ein Kirchenraum zu einem Raum wird, der dann beispielsweise einen Industriebetrieb beherbergt, das halte ich nicht für sehr realistisch.
Der Dienst an den Menschen soll, so hat es das Ordinariat ausgegeben, Vorrang haben vor dem Erhalt von Gebäuden. Können Sie diese Forderung anhand eines Beispiels verdeutlichen?
Klingan: Wir sind gemäß der Botschaft Jesu Christi für die Menschen da, und wir sind mit Menschen für die Menschen da. Das ist für uns die erste Priorität. Daher sind die Personalkosten auch unser höchster finanzieller Ausgabeposten. Es geht uns aber nicht nur um die Hauptamtlichen, sondern ganz entscheidend um die Ehrenamtlichen, die sich in die Kirche einbringen. Daher schauen wir als Erstes, was es an pastoralem Leben vor Ort gibt und was die Menschen vor Ort gestalten wollen. Im zweiten Schritt gilt es dann zu entscheiden, was es für Rahmenbedingungen braucht. Gebäude sind dafür nur ein Mittel, aber nicht der Zweck.